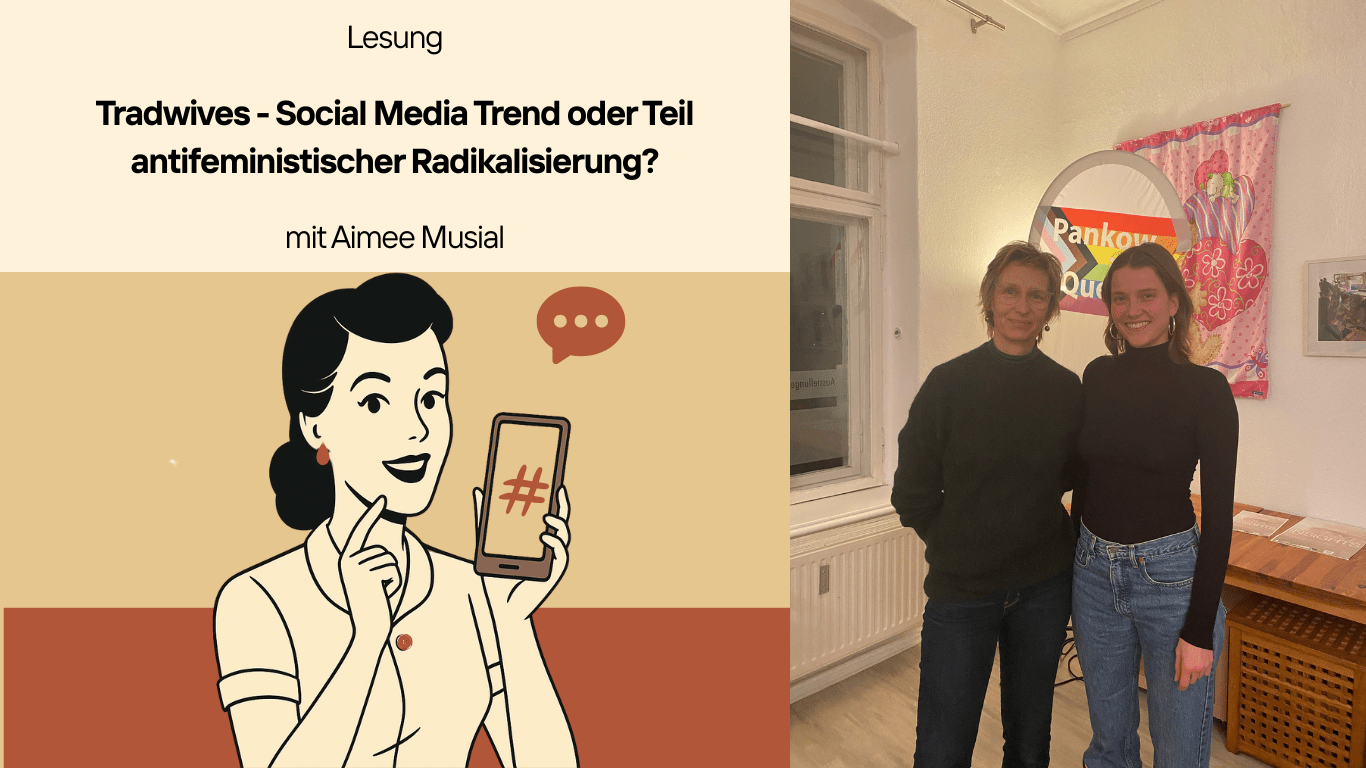Tradwives (= „traditional wives“) gehören inzwischen fest zur digitalen Landschaft der Bloggerinnen und Influencerinnen. Auf Plattformen wie Instagram, TikTok oder YouTube präsentieren sie ein Leben voller Hausfrauenidylle, Naturverbundenheit und traditioneller Rollenverteilung. Pastellfarbene Küchenszenen, aufwendige Rezepte und perfekte Familienharmonie vermitteln einen einfachen, entschleunigten und vor allem erfüllenden Lebensstil. Dieser Content kommt an: Tradwives gewinnen täglich an Reichweite und haben ihren Online-Lifestyle zu einer wachsenden Bewegung umgewandelt.
Oft wird der sichtbare Beginn dieses Trends mit einem viel diskutierten BBC-Interview aus dem Jahr 2020 verknüpft. Darin beschreibt die Bloggerin Alena Kate Pettitt ihr Familienmodell mit den Worten: „Ich unterwerfe mich meinem Mann, als wäre es 1959.“ Als „stay-at-home“-Ehefrau und Mutter inszeniert sie traditionelle Rollenbilder als natürlich, sinnvoll und zutiefst erfüllend. Ein Verständnis, das auch dem zugrunde liegt, was Aimee Musial in ihrer Forschung als Kern des Tradwife-Konzepts benennt.
Doch hinter dieser Ästhetik steht ein Weltbild, das weit über Lebensweisen hinausgeht und Gefahren birgt, die auf den ersten Blick kaum erkennbar sind. Bei unserer Lesung im Frauenzentrum Paula Panke mit Aimee Musial am 20. November 2025 beleuchteten wir gemeinsam, welche Ideologien die Tradwife-Bewegung prägen, warum sie gerade jetzt so populär ist und wie wir feministisch darauf reagieren können.
Aimee Musial präsentierte dabei zentrale Erkenntnisse aus ihrer Bachelorarbeit „Tradwives im Spannungsfeld zwischen Geschlechterperformativität und gesellschaftlichen Machtverhältnissen – Eine wissenssoziologische Diskursanalyse anhand von ausgewählten Tradwife Beiträgen auf Instagram“. Dafür analysierte sie 80 Instagram-Beiträge von acht US-amerikanischen Tradwife-Accounts mit großer Reichweite und untersuchte ihre visuellen Inszenierungen, Bildunterschriften und Erzählweisen.
Weltbild und Selbstinszenierung: Tradition als Lösung?
Die untersuchten Accounts vermitteln ein klar strukturiertes Weltverständnis: christlich-konservativ und an einem „traditionellen“ Familien- und Frauenideal orientiert. Viele Tradwives stellen ihre Lebensweise als „Ausbruch aus der Matrix“ dar. Mit Matrix ist hierbei eine moderne Welt gemeint, die angeblich Sinn, Natürlichkeit und klare Rollen verloren habe. Sie propagieren:
-
- die Rückkehr zur „weiblichen Bestimmung“ in Haus- und Familienarbeit
-
- Mutterschaft als natürlichen und einzig erfüllenden Lebensinhalt
-
- Unterordnung unter den Ehemann als „Ausdruck von Liebe“
-
- eine idealisierte Einfachheit des Landlebens, Selbstversorgung und Entschleunigung
Das Zuhause erscheint dabei als „weiblicher Ort“, den die Frau harmonisch, liebevoll und ästhetisch gestaltet. Visuell dominieren Blumenkleider, retroinspirierte Outfits und stereotype Darstellungen von „Homemaking“.
Paradoxa und Ausblendungen
Doch vieles an dieser Darstellung ist widersprüchlich: Tradwives kritisieren moderne Lebensweisen, in denen Frauen karriereorientiert und selbstbestimmt für ihren Lebensunterhalt sorgen. Gleichzeitig verdienen sie jedoch über ihren Social Media Content Geld und unterlaufen damit das von ihnen propagierte „Male Breadwinner“ Modell. Ihr Tradwife-Dasein wird häufig als Ausweg aus der Doppelbelastung von Erwerbsarbeit und Care-Arbeit erzählt – als Rückzug in ein entschleunigtes Leben jenseits von kapitalistischen Anforderungen. Durch ihre Content-Produktion geraten sie jedoch wieder in genau diese Doppelbelastung hinein, auch wenn sie weiterhin die Idee eines mühelosen, häuslichen Rückzugs vermarkten.
Hinzu kommt die ästhetische Inszenierung von Selbstversorgung durch eigenen Anbau und Tierhaltung, während realistische Bedingungen – Zeit, Geld, räumliche Ressourcen – kaum thematisiert werden.
Zusätzlich werden Lebensrealitäten ausgeblendet, die nicht in das idyllisierte Bild passen: alleinerziehende Mütter, queere Familien, nicht-weiße Familien, sozial benachteiligte Haushalte oder Frauen, die außerhalb des Hauses arbeiten müssen. Das Tradwife-Ideal ist somit nicht nur normativ, sondern trägt auch zur Reproduktion klassistischer und rassistischer Narrative bei.
Folgen für die Lebensweise und die Zuschauenden
Die radikale Fokussierung auf Familie und Häuslichkeit erzeugt nicht nur ein idealisiertes Bild, sondern auch problematische Abhängigkeiten:
-
- Intransparenz über Belastungen, Isolation und psychische Risiken
-
- Privatisierung gesellschaftlicher Probleme (z. B. Kinderbetreuung, finanzielle Unsicherheit)
-
- Verfestigung eines binären, heteronormativen Geschlechtersystems
-
- Reduktion von Frauen auf Mutterschaft und Fürsorge
-
- Normalisierung von finanzieller und emotionaler Abhängigkeit vom Ehemann
Für die Zuschauenden entsteht ein zusätzliches Risiko: Die gezeigte Einfachheit ist für die meisten Familien real nicht umsetzbar: nicht ohne Einkommen von zwei Elternteilen, nicht ohne soziale Netzwerke oder öffentliche Infrastruktur. Gleichzeitig gilt das eigene Zuhause statistisch als der gefährlichste Ort für Frauen – ein Aspekt, den Tradwife-Accounts vollständig ausblenden. Mehr dazu thematisieren wir auch in unserem Beitrag zur Lesung über Femizide mit Gisela Zimmer.
Verbindung zu rechten Ideologien
Im Anschlussgespräch zur Lesung erkennen wir, dass Tradwife-Inszenierungen strukturell an rechte, völkisch-nationale Narrative erinnern. Sie reproduzieren ein Bild der weißen, heterosexuellen Kernfamilie als gesellschaftliches Ideal, naturalisieren männliche Dominanz und blenden strukturelle Ungleichheiten aus. Rechtsextreme Codes und Vorstellungen einer „Lösung der Frauenfrage“ finden sich in Teilen der Szene wieder. Zwar häufig subtil, aber ideologisch mit Sicherheit wirksam. Damit trägt das Phänomen zur Stabilisierung eines kapitalistischen und patriarchalen Gesellschaftsmodells bei: weibliche Reproduktionsarbeit wird romantisiert und entpolitisiert, während Männern die gesellschaftliche Bühne überlassen bleibt.
Diskussionsrunde und Ausblick
Uns wurde deutlich, wie groß das Interesse, aber auch die Unsicherheit im Umgang mit diesem Trend ist. Wir diskutierten, warum gerade Frauen für Tradwife-Inszenierungen kritisiert werden, statt die zugrunde liegenden Mechanismen von Patriarchat, Kapitalismus, Rassismus und digitalen Plattformen in den Blick zu nehmen. Ihre Ästhetik mag harmlos und unterhaltsam wirken, aber sie reproduziert Geschlechterrollen, die der Feminismus seit Jahrzehnten zu überwinden versucht. Die Frage „Was können wir tun?“ zog sich entsprechend durch die Debatte.
Unser Fazit: Es braucht Aufklärung, feministische Analyse und politische Handlungsbereitschaft, um diesen Ideologien entgegenzuwirken. Sichtbarkeit, Bildung, Aktivismus und solidarische Netzwerke sind entscheidend, um der Romantisierung traditioneller Rollenbilder etwas entgegenzustellen und um deutlich zu machen, dass Fürsorgearbeit gesellschaftliche Verantwortung ist, keine individuelle „Berufung“.